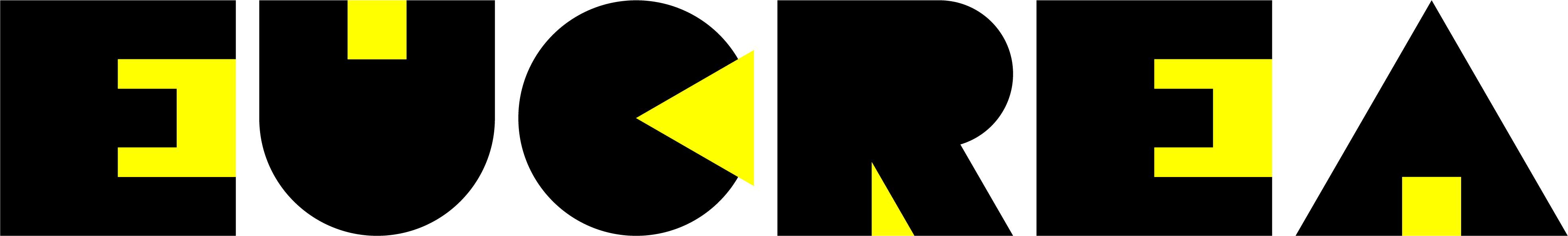SPRENGEL MUSEUM HANNOVER / KÜNSTLERGRUPPE WILDERERS (DIAKONIE HIMMELSTHÜR E.V.)
Hier den ganzen Text und Interviews lesen
Hier eine zusammenfassung in Einfacher Sprache lesen
Das Sprengel Museum Hannover zählt mit seiner umfangreichen Sammlung und dem vielfältigen Ausstellungsprogramm zu den bedeutendsten Museen der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Das Museum will sich im Rahmen des Programms CONNECT mit dem Thema beschäftigen, wie das dortige Vermittlungsprogramm inklusiver gestaltet werden kann. Das 2017 gegründete Atelier „Wilderers“ befindet sich in der Innenstadt Hildesheims. Die Künstler:innen arbeiten teilweise seit 2000 zusammen und verfügen über langjährige Erfahrungen im Ausstellungswesen sowie in der Interaktion mit Besuchern im Rahmen von Kunstprojekten und inklusiven Veranstal-tungen. Seit 2017 bietet der Träger proteam gGmbH Voll- und Teilzeitarbeitsplätze für Künstler an. Das Atelier wird regelmäßig für Besucher:innen als künstlerischer Aktionsraum und als Galerie geöffnet.
Zunächst fand im Juli 2019 ein Besuchstag von Künstlern aus dem Atelier Geyso20 sowie dem Atelier Wilderers statt. Sie lernten das Haus, das Vermittlungspersonal, die Sammlungen und Ausstellungen kennen und setzten sich in Workshops künstlerisch mit diesen auseinander.
Aus den Ergebnissen des unten beschriebenen Fachtages inklusive Kultur-vermittlung vom 26.11.2019 wurde ein Konzept für die weitere Zusammenarbeit beider Institutionen entwickelt.

Mittagsgespräche
Seit 2019 besuchten die Kunstschaffenden des Atelier Wilderers das Museum regelmäßig. Sie arbeiteten in der Sammlung und bezogen sich auf einzelnen Künstler oder Bilder bzw. Objekte. Sie befanden sich im regelmäßigen Austausch mit den Mitarbeiter:innen der Kunstvermittlung des Museums, die bereits mehrfach das Atelier der Wilderers in Hildesheim besucht hatten. Mittlerweile haben sich drei Künstler:innen herausgebildet, die ihre Werke in dem Format "Mittagsgespräche" präsentieren werden. Die "Mittagsgespräche" sind regelmäßig stattfindende 20-minütige Gespräche zwischen einem Künstler bzw. einer Künstlerin und der Muse-umsvermittlerin Gabriele Sand, in denen künstlerisch Stellung zu einem Werk aus der Sammlung bezogen wird. Den Auftakt machte Patrick Premke am 01.09.2020. Dann kam eine coronabedingte Pause. Ein weiteres Gespräch folgte am 11.11.2021 mit Christfried Behrens, ebenfalls aus dem Atelier Wilderers Hildesheim, der Paul Klees Werk "Nacht-Blüte" von 1938 interpretierte.
Ziele der Kooperation sind, Künstler:innen mit Behinderung im Vermittlungsbetrieb des Museums für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen und andere Wahrnehmungsweisen auf Kunst zu vermitteln. Die Kooperationspartner:innen wollen deutlich machen, dass der Kunstbetrieb durch mehr und verschiedenartige Perspektiven nur bereichert werden kann.

Fachtag Inklusive Kulturvermittlung am Dienstag, den 26.11.2019, im Sprengel Museum Hannover
Mit diesem Fachtag wurden Ansätze vorgestellt, wie inklusive Vermittlungsformate in Museen und Ausstellungshäusern erfolgreich umgesetzt werden können. Dafür hat EUCREA das Team aus dem Kunsthaus KAT18 (Köln), dem Kunstmuseum Bonn sowie die Gruppe <Platz da!> aus Berlin eingeladen, ihre Arbeit im Rahmen eines Fachtags vorzustellen. In Workshops wurden Ideen entwickelt, wie inklusive Vermit-tlungsarbeit im Sprengel Museum in Zukunft umgesetzt werden kann.
Der Fachtag wendete sich an alle am Programm CONNECT beteiligten Partner sowie Einrichtungen in Sachsen, Niedersachsen und Hamburg. Einzelne Interessenten aus anderen Bundesländern konnten berücksichtigt werden.
projektvideo
Untertitel
man kann das
museum in
anspruch nehmen
und forderungen
stellen:
es ist ein gegEnseitiges
“voneinander-lernen”.
diversität und inklusion
SIND ein
dialogischer prozess.
Museumspädagogik wurde in den 80er Jahren mit dem Ziel gegründet, museale Themen und Exponate möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Inwieweit konnte die Museumsvermittlung im Sprengel Museum bisher Menschen mit Behinderung erreichen?
Gabriele Sand: In der Tat hat sich in den 1980er-Jahren ein stärkeres Bewusstsein für die Diversität der Gesellschaft entwickelt. Daraus entstand dann nach und nach eine Sensibilität für die Verschiedenheit der Besucher:innengruppen. Ebenso wurde über die Spezifik der einzelnen Zielgruppen nachgedacht: Braucht es spezielle Programme und Vermittlungskonzepte, und wie können diese realisiert und an die verschiedenen Besucher:innengruppen adressiert werden? Diese Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Realität hat dazu geführt, dass weniger das Museum als traditionelle Kulturinstitution in den Mittelpunkt gestellt wurde, als dass vielmehr die Besucher:innen in den Fokus rückten. Neben der Betonung eines kulturellen Bildungsauftrags, der vor allem eine aktive Arbeit im Bereich Museum und Schule motivierte, sind es Anspruch und Möglichkeit, über „zielgruppenspezifische Programme“ eine Öffnung des Museums alle Bereiche der Gesellschaft erreichen zu können. Dieser Anspruch ist Forderung und Bedingung museumspädagogischer Vermittlungsarbeit zugleich. Zudem ist an vielen Museen und Kunst und Kulturinstitutionen eine große und kreative Flexibilität im Umgang mit den unterschiedlichen Besucher:innengruppen entstanden.
Im Sprengel Museum Hannover versuchen wir, allen Gruppen einen Museumsbesuch zu ermöglichen und ein auf sie abgestimmtes Pro-gramm zu entwickeln. Förderschulen und Inklusionsklassen nehmen regelmäßig unsere museumspädagogischen Angebote wahr. Im Vorfeld sind intensive Vorbereitungsgespräche möglich, um den Besuch und das Vermittlungsprogramm abzustimmen. Darüber hinaus ist das Museum physisch barrierefrei und verfügt über zentrale und speziell eingerichtete Räume für eine aktive Arbeit mit den Besucher:innen.
Bereits in den frühen 1980er sJahren konnten mit der Ausstellung „Skulptur begreifen“, einer Tastgalerie mit ausgewählten Skulpturen, wichtige Impulse für den Diskurs der Blindenpädagogik gesetzt werden. Zurzeit versuchen wir das Format einer musikalischen Führung für Blinde und Sehbehinderte mit dem „Orchester im Treppenhaus“ zu etablieren und in das regelmäßige Angebot des Führungsprogramms zu integrieren. Dieses Projekt führte außerdem zu einem intensiveren Kontakt zum Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, mit dem wir aktuell Sensibilisierungstrainings für Museumspädagog:innen in Hannover organisieren und durchführen.
Dörte Wiegand: Wir haben in Hannover den spartenübergreifenden Arbeitskreis „Kultur und Demenz“ gegründet. Damit möchten wir individuelle Angebote verschiedener Initiativen und Institutionen aus dem Feld bewerben und uns gegenseitig beraten und unterstützen. Gemeinsam planen wir, vierteljährlich ein Quartalsprogramm herauszugeben, das die individuellen Angebote der einzelnen Beteiligten bündelt und mit dem wir an Vereine und Verbände herantreten können. Oftmals ist es leichter, diesen Weg zu gehen als direkt Kontakt zu Betroffenen und Angehörigen aufzunehmen, also privat Familien anzusprechen. Überhaupt ist es unser Ziel, in Zukunft vermehrt mit Verbänden Kontakt aufzunehmen und zusammenzuarbeiten. Diese Verschränkung, die Zusammenarbeit mit Expert:innen in eigener Sache auch in anderen Bereichen, sind enorm wichtig, um voneinander zu lernen und gemeinsam nach Wegen für eine stärkere inklusive Öffnung zu suchen. Es ist auch als Signal unsererseits zu verstehen, dass wir Interesse haben und dazulernen möchten.
Ein wichtiger Kontakt in diesem Zusammenhang ist das Atelier Wilderers aus Hildesheim, das im Rahmen des Programms CONNECT mit EUCREA entstanden ist und mit dem wir unsere Zusammenarbeit weiter ausbauen möchten. Mit der Künstlerin Silke Lüdecke, die seit vielen Jahren in dem Atelier tätig ist, planen wir beispielsweise Ferien-Workshops für Kinder und Jugendliche zu ihrem künstlerischen Ansatz. Ihre sogenannten Trostpuppen, die aus Wolle und Stoffen gestaltet sind und zu denen sie ein Kinderbuch entwickelte, werden uns dabei ebenso inspirieren wie das Werk von Niki de Saint Phalle. So ein mehrtägiger Workshop muss allerdings sorgfältig geplant werden – dazu gehört auch der regelmäßige intensive Austausch innerhalb des Teams. Silke und ich brauchen Zeit, um uns kennenzulernen, Vertrauen zu schöpfen und uns bestmöglich aufeinander einstellen zu können.
Gabriele Sand: Die Tagung im Rahmen von CONNECT im September 2020 war in diesem Zusammenhang sehr motivierend und hat durch Vorträge und intensiven Austausch viele Anregungen gegeben. Oftmals wird das Museum als eine intellektuelle und akademische Institution wahrgenommen, und man trifft immer wieder Menschen, die denken, dass sie mit ihrer Behinderung im Museum keinen Ort finden können. Daher ist es wichtig, zu signalisieren: Man kann das Museum in Anspruch nehmen und Forderungen stellen. CONNECT hat dies für kulturelle Institutionen dargestellt und bestätigt.
Jetzt stellt sich die Frage, wie man Menschen mit Behinderung über soziale Medien abholen kann. Die bisherige Form der Verbandsorganisation wird sich sicher verändern.
Gabriele Sand: Das ist in der Tat eine Herausforderung. Meist greifen die herkömmlichen Wege der Öffentlichkeitarbeit nicht; zurzeit versuchen wir an die verschiedenen Verbände heranzutreten, um zu lernen, wie wir die die Möglichkeiten des Museums vermitteln und publik machen können.
Ein anderer Weg ist die Zusammenarbeit mit Einrichtungen – wie mit dem Atelier Wilderers aus Hildesheim. Eine Gruppe der Künstler:innen kommt regelmäßig ins Museum, um vor den Originalen Studien anzufertigen. Das Museum ist für sie zu einem Atelier geworden, ein vertrauter Ort, der wie selbstverständlich für die eigene künstlerische Arbeit genutzt werden kann. In Einzelgesprächen vor den Kunstwerken und über ihre eigenen im Museum entstandenen Zeichnungen findet ein reger Austausch statt. Daraus ist die Idee entstanden, die Erfahrung dieses künstlerischen Dialogs in ein Vermittlungsformat des Museums zu integrieren. Das Kunstgespräch um „12 Uhr-Mittag“, eine 20-minütige Bildbetrachtung, die regelmäßig jeden Donnerstag im Programm des Museums stattfindet, ist hierfür eine gute Möglichkeit. Begleitet von Museumspädagog:innen wird die eigene Zeichnung im Dialog mit den entsprechend ausgewählten Werken aus der Sammlung präsentiert. Das Museum profitiert so von dem Know-how, das sich der:die jeweilige Künstler:in im Museum angeeignet hat, indem er:sie sich in sogenannten Nachbildern mit den Kunstwerken auseinandergesetzt
und eine eigene Bildsprache und Vorstellungen erarbeitet hat.
Auf diese Weise entsteht ein subjektiv geprägter und interessanter Dialog zwischen Kunstwerk, Künstler:in und dem Publikum. Für die Künstler:innen ist es eine gute Erfahrung, von ihrer Kunst zu erzählen, Fragen zu beantworten und ein entsprechendes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Das Programm funktioniert gut und wird vom Museumpublikum angenommen.
Ob diese Herangehensweise auf andere Gruppen übertragbar ist, werden Projekte in der Zukunft zeigen. Möglich wäre z.B. eine Führung in Gebärdensprache, die dann für das hörende Publikum übersetzt wird. Es geht bei alldem vor allem um das „Sichtbarmachen“ an einem öffentlichen Ort wie dem Museum und Akzeptanz dafür zu schaffen, dass Menschen mit Behinderung als aktive Kunstschaffende, Vermittler:innen und Besucher:innen wahrgenommen werden.
Dörte Wiegand: Teilweise sind sicherlich spezielle Programme zu entwickeln, zum Beispiel auf bestimmte Beeinträchtigungen zugeschnittene Formate. Allerdings müssen wir darauf achten, dass auf diese Weise nicht erneut „exkludiert“ wird. Wir müssen dynamisch bleiben, unseren Wunsch nach Inklusion im Blick behalten und außerdem spezifische Rahmenbedingungen bei Bedarf schaffen. So können wir Sicherheit geben, Zugänglichkeit möglich machen und ein breites Publikum ansprechen. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen.
Es ist außerdem wichtig, das eigene Team zu sensibilisieren, weil das Thema institutionell von Relevanz ist, der Inklusionsanspruch von der gesamten Einrichtung getragen und unterstützt werden muss. Die Museumsaufsichten ebenso wie die Mitarbeitenden am Empfang sollten wir ins Boot holen. In der Kommunikation, im Umgang miteinander bedarf es möglicherweise ein bisschen mehr Geduld und Zeit, dafür sollten wir Verständnis entwickeln. Je häufiger Menschen mit Beeinträchtigung das Museum besuchen, desto selbstverständlicher werden solche Situationen für alle Beteiligten.
Was verändert sich im Museum, wenn Menschen mit Lernschwierigkeiten zu Vermittelnden werden? Das ist ein Paradigmenwechsel: Bisher wurde Kunst von Personen vermittelt, die an einer Hochschule ein entsprechendes Studium absolviert haben. Welche Bedeutung hat diese Veränderung für die Museumsvermittlung?
Gabriele Sand: Zunächst: Die meisten Besucher:innen nehmen an einem Vermittlungsangebot im Museum oder in Ausstellungen teil, um sich über Kunst und Künstler:innen zu informieren und wollen kunsthistorische oder kunstwissenschaftliche Orientierungshilfen, sei es in Führungen, Vorträgen oder auch Künstler:innengesprächen. Diesem Bedürfnis und dieser Forderung muss das Museum in seinen Programmen Genüge tun. Dennoch und eigentlich ist das Museum eine große Maschine des Sehens und der Wahrnehmung. Und Vermittlung im Museum sollte sich als Motivation einer Sensibilisierung von Sehen und Wahrnehmen verstehen. Das ist ein subjektiver und individueller Prozess, der auf vielen Ebenen entstehen und stattfinden kann.
Die von Ihnen genannten Bespiele sind Formate, die dies belegen, wie ebenso auch die Zusammenarbeit mit dem Atelier Wilderers im Sprengel Museum Hannover. Und natürlich profitiert die Vermittlungsarbeit im Museum von diesen Projekten und Formaten allein aus dem Grund, dass diese Projekte eine intensive Vorbereitung in Anspruch nehmen, die sehr viel Austausch und Reflexion mit den Teilnehmenden, den Kooperationspartner:innen und den Museumspädagog:innen vor Ort braucht: Es ist ein gegenseitiges „Voneinander-Lernen“.
Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Teilhabe an kulturellen und gesellschaftlichen Angeboten öffentlicher Institutionen oder Veranstaltungen – Museen, Theater, Oper oder Konzerthäuser – bereits ein Aspekt in der Ausbildung derjenigen sein sollte, die später ihren Schwerpunkt in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung haben. Oft ist es die Skepsis der Betreuer:innen, die immer wieder zitierte „Schwellenangst“, die Einrichtungen und Verbände davon abhalten, sich aktiv an die Museen zu wenden. Diversität und Inklusion sind ein dialogischer Prozess.
Dörte Wiegand: Noch einmal zurück zu der Frage nach der Bedeutung von Formaten und Herangehensweisen, wie sie auf dem Fachtag
„Inklusive Kulturvermittlung“, den EUCREA und das Sprengel Museum im November 2019 veranstaltet haben, vorgestellt wurden: Diese Projekte können ein Museum vielstimmiger werden lassen, mehr Menschen werden zum Sprechen gebracht. Ebenso wird die angesprochene Deutungshoheit angetastet. Letztlich wird dadurch auch viel auf der Metaebene bewegt: Was verändert sich dadurch für die Institution und unsere Arbeit? Was macht es mit unserem Selbstverständnis?
Dieses Moment des Perspektivwechsels ist bereichernd auch für die Vermittlungssituation. Es bietet die Möglichkeit, selbst in eine andere Rolle zu schlüpfen oder aus einem anderen Blickwinkel zu gucken, mit anderen Fragen konfrontiert zu werden. Viele Fragen zum Beispiel, die Schüler:innen im Verlauf eines Vermittlungsprogramms zu Werken aus der Sammlung stellen, sowie einzelne Ideen und Beobachtungen sind so spannend und inspirierend, dass sie meinen eigenen Blick nachhaltig verändert haben.
Von der Museumsseite finde ich es aber auch legitim zu sagen: „In welche Projekte investieren wir zunächst einmal? Worauf konzentrieren wir uns?“ Wir können nicht alles auf einmal möglich machen, wenn wir den Anspruch haben, bestenfalls gemeinsam mit Fokusgruppen und Expert:innen in eigener Sache gute Angebote zu gestalten, die sinnvoll sind, Interesse wecken und entsprechend angenommen werden. All das braucht Zeit. Um den einzelnen Themen gerecht zu werden, müssen wir uns fokussieren. Dies
gibt Projekten, wie jenem mit den Künstler:innen des Atelier Wilderers, die Chance, sich zu entwickeln. Wir können es angemessen begleiten, evaluieren und im Dialog mit den Wilderers ausbauen. Dies dient letztendlich der Qualität und der Nachhaltigkeit der einzelnen Angebote, und wir haben die Möglichkeiten, unsere eigenen Lernerfahrungen als solche wahrzunehmen und zu reflektieren.
Vor drei Jahren war ich in der Tate Modern in London: Im Foyer rollte ein Skater, da waren Cafés, eine Bibliothek, offene Ausstellungsbereiche – atmosphärisch wie in einem Einkaufszentrum für Kunst. Unsere deutschen Museen sind nach wie vor eher stille Orte...
Gabriele Sand: Der Vergleich der Tate in London mit einem Einkaufszentrum ist sehr gut gewählt mit den Millionen Besucher:innen und Tourist:innen, die dieses Museum zu bewältigen hat. Konzentrierte Aktionen oder Führungen sind da eher schwierig, das ist zumindest meine Erfahrung an diesen touristischen Knotenpunkten. Die große Turbinenhalle mit den wechselnden Installationen, den vielen Cafés und Museumsshops, die Rolltreppen und Fahrstühle, all dies vermittelt eine große Offenheit; eine konzentrierte Kunstbetrachtung ist in dieser Situation allerdings eine Herausforderung.
Also doch Musentempel? Letztlich muss sich das Museum gesellschaftlich verorten, und da sind Bildung, Inklusion und Diversität die aktuellen Herausforderungen, und
das gilt für die englischen Museen ebenso wie für die Situation in deutschen Institutionen. Es ist eine Frage der Art und Weise, wie man mit diesem Musentempel umgeht und wie man das Angebot, das die ausgestellte Kunst darstellt, aktiv in die Gesellschaft trägt.
Museen haben eine Vorbildfunktion in Bezug auf Diversitätsentwicklung.
Gabriele Sand: Als eine öffentliche Institution können oder sollten Museen sogar eine Vorbildfunktion erreichen. Es sind eine Herausforderung und ein Prozess, denen sich die Kulturinstitutionen stellen müssen. Institutionen sollten sich in diesem Zusammenhang immer wieder hinterfragen und in den gesellschaftlichen Dialog treten mit allen, die die Vielfalt dieser Gesellschaft repräsentieren.